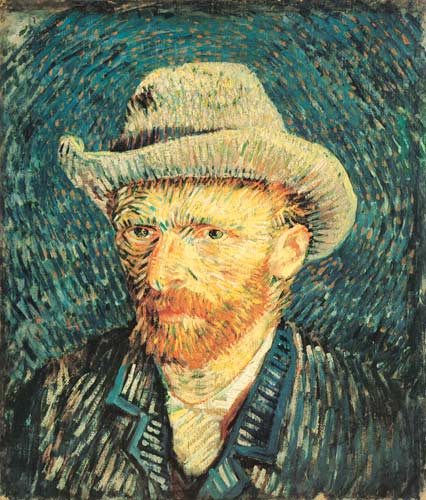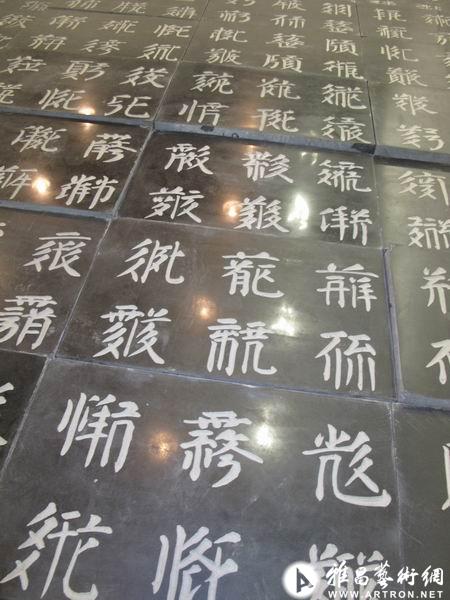Der Text „Das totale Archiv“, den eine Fachzeitschrift über Themen der Musik und der Ästhetik als „stalinistisch“, „medienfaschistisch“ und „neoliberal“ abgelehnt hat, wird stattdessen nächstes Jahr im Sammelband „Musik mit Musik – Texte 2005-2011“ im Wolke-Verlag erscheinen. (Kulturtechno berichtete)
Hiermit beginne ich eine Vorab-Blog-Version in zwölf Teilen, mit der ich den momentanen Stand zeigen und zur Diskussion stellen möchte.
Das totale Archiv
1. Neu und alt
War das Lautgedicht, die Rezitation sinnlicher, aber sinnfreier Wörter, das Hugo Ball 1916 im Zürcher Cabaret Voltaire präsentierte, etwas Neues? Christian Morgenstern hatte es schon erfunden, wenn überhaupt, und die Dadaisten wussten das. Bei den Dadaisten war wohl aber doch, angesichts des tobenden Weltkriegs und ihres ikonoklastischen Protests dagegen, das Lautgedicht qualitativ etwas anderes als beim verspielten Morgenstern zwanzig Jahre früher. Der Grad der Neuheit ist jedoch inkommensurabel und immer findet sich jemand (zum Beispiel die damalige Presse), der gleich abwinkt: „Gab’s doch schon!“
Ganz konkret betrachtet ist auch ein nur dastehendes Auto bereits zehn Minuten später ein anderes; steht es noch in fünfzig Jahren da, ist es, wenn es sich auch materiell überhaupt nicht geändert hätte, zum Oldtimer gewandelt. Umgekehrt, je stärker man Prinzipien abstrahiert, bleibt die Welt immer ‚gleicher’: Dem Fluxus-Stück ONE for a violin von Nam June Paik, bei dem mit einer Geige, am Griffbrett gehalten, ganz langsam vor einer Tischkante ausgeholt wird, um sie zuletzt daran zu zerschmettern, hielt ein Kritiker spöttisch vor, das sei im Grunde doch wieder tonale Musik, Spannung-Entspannung, Dominante-Tonika. Die hinuntergehauene Geige ist auch nur ein Abbild der platonischen Kadenz.
Hier streiten sich Konkretion und Abstraktion oder lineare und zyklische Geschichtsvorstellungen. Friedrich Nietzsche meinte, dass sich alles permutativ wiederholen müsse, wenn die Zeit ewig weiterläuft, aber die Materie begrenzt ist. Dem steht der zweite Satz der Thermodynamik gegenüber, wonach es irreversible Prozesse gibt. Licht, das auf Wasser fällt, erwärmt dieses, aber die Wärme wird nicht wieder Licht. Das Universum verdunkelt langsam aber sicher. Die Lehre der ewigen Wiederkehr hingegen entspräche einem Perpetuum mobile.
Ob der Langsamkeit der Verdunklung soll aber auch gefragt werden: Wie fühlt es sich an? Ein nicht unberechtigtes Modewort ist der Ausdruck „gefühlt“; „gefühlte Temperatur“, „gefühltes Alter“, „gefühlte Länge“ – die subjektive Korrektur schnöder Fakten.[1] Senioren äußern gern, dass sie nichts mehr überrascht, weil sie das Leben kennen. Die Zeit ist zwar ein Fluss, und darum ist alles, auch das Auto in zehn Minuten, immer neu, aber vielleicht nur im nichtigen Detail. Die Fülle des Neuen ist unendlich, aber man muss sie nicht dramatisieren, sie ist größtenteils ‚schlecht unendlich’. Getreue Wiederkehr gibt es nicht, „gefühlte“ ziemlich oft, Typen zeichnen sich ab, leere Spektakel ohne neue Qualitäten. Jeder Begriff ist ein Begriff des Unvermögens oder Unwillens, die Unendlichkeit zu sehen.
Neu und alt greifen meist ineinander. Im Hinblick auf die technologischen Entwicklungen können wir das hiesige Zeitalter als sehr progressiv empfinden, gerade darum können wir aber auch die Wiederholungen deutlicher sehen. Die neuen Datenmassen lassen sich oft nur durch Verallgemeinerungen und Ähnlichkeiten strukturieren, wie überhaupt der Mensch in Zyklen und Analogien denkt und plant, in wiederkehrenden Mustern gerade beim sich Ändernden. Der größte Neurer in der Musik, Arnold Schönberg, war immerzu mit Erklärungen bemüht, wie sehr er doch in der Tradition stünde. Und die Uhr ist, obwohl die Zeit immer weiterfließt, rund.
Man hat die neue Technik als Erweiterung der menschlichen Natur beschrieben: „Der Hammer ist die Faust, die Schaufel die Grabhand; die Mühle, die das Korn mahlt, nimmt den Zähnen die Arbeit ab. Der Motor, der Wagen und Flugzeuge treibt, leistet, was Beine und Flügel, wenngleich langsamer, dem Wesen nach auch leisten.“ (Ernst Jünger),[2] Marshall McLuhan sah in vernetzten Computern eine Art Nervensystem,[3] Peter Glaser setzt den Livestream in Bezug zum Fluss, an dem sich früher die Siedler niederließen,[4] den Monitor zum Lagerfeuer, der uralten Illumination, auf die der Mensch seit jeher starrt.[5]
Die Gegenseite meint, Maschinen seien keine homomorphen Erweiterungen, sondern „Eskalationen“ (Friedrich Kittler) mit Eigengesetzlichkeit; Hans Blumenberg nach stiegen beispielsweise die Brüder Wright aus der Logik der natürlichen Fortsetzung aus, indem sie Flugmaschinen mit Luftschrauben bauten – rotierende Organe seien der Natur fremd.[6] Das Rad ist der Sündenfall. Nicht selten hinken auch die Vergleiche von digitaler und analoger Welt, wenn zum Beispiel von Software-Diebstahl gesprochen wird, obwohl im Digitalen faktisch nicht weggenommen, sondern vervielfältigt wird. Doch kommt man schwer umhin, sich die neue Welt mit bekannten Prinzipien und Erfahrungen klarzumachen, und vielleicht ist das sogar die beste Strategie, den Überblick über den Fortschritt zu behalten.
Wörter konservieren: Das Kino nannte man anfangs „Lichtspiel“, als Alternative zum Schauspiel; die Leistung des Autos wird auch heute noch in „Pferdestärken“ aufgerechnet. Filme werden „gedreht“, obwohl Kameras mit Kurbeln längst passé sind, und selbst beim digitalen Video wird „vorgespult“, wiewohl sich im Computer dafür keine Spule befindet. Auf dem Handy „legt“ man noch „auf“, obwohl kein Hörer auf die Gabel kommt, und ein „DiscJockey“ legt heute keine Discs mehr auf. Bald werden junge Menschen nicht mehr wissen, dass ein „Ordner“, bevor er Dateien unterbrachte, auch mal ein physisches Ding war.
[1] Dazu: Marc Reichwein, G wie gefühlt, in: Die Welt vom 1.7.2011. http://bit.ly/r6UoQZ , recherchiert am 30.8.2011.
[2] Ernst Jünger, An der Zeitmauer, in: Gesammelte Werke, Zweite Abteilung, Essays Band 8, Stuttgart 1981, S. 55.
[3] Marshall McLuhan, Understanding Media, New York 1964, S. 3.
[5] Peter Glaser, Die digitale Faszination – Vom Leben auf dem achten Kontinent, in: Glaserei vom 14.4.2010, http://bit.ly/ohtb7i, recherchiert am 30.8.2011.
[6] Martin Mayer, Ernst Jünger, München 1990, S. 501.