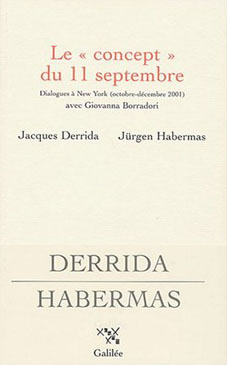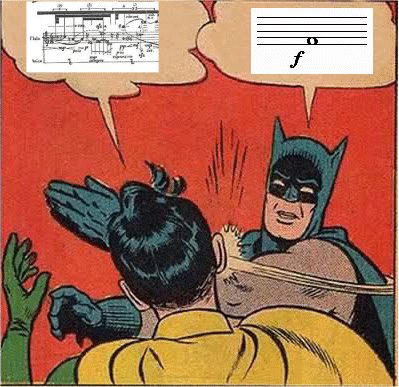Die existenziale Struktur des im Gewissen bezeugten eigentlichen Konzeptkönnens
Warum sind wir so voll Hemmungen? Warum geben wir uns nicht nach allen Richtungen aus? Aus Angst, uns zu verlieren? Ehe wir uns nicht verloren haben, besteht keine Hoffnung, uns zu finden. Wir gehören der Welt an, und um ganz in sie ein- zutreten, müssen wir uns zuerst in ihr verlieren. (Miller)
Gerade ein Buch gelesen, in dem statt von „Geschlechtsteilen“ von den „Genussteilen“ die Rede ist. Sehr gut. In „Geschlecht“ steckt ja auch noch „schlecht“.
„Dialektik der Aufklärung“ für Oboe solo
„Minima Moralia“ für Frauenchor
usw.
Heidegger, Sein und Zeit, Inhaltsangabe, das Wort „Sein“ mit dem Wort „Konzept“ und das Wort „Zeit“ mit „Konzeptmusik“ ersetzt.
Inhalt
Einleitung
Die Exposition der Frage nach dem Sinn von Konzept
Erstes Kapitel
Notwendigkeit, Struktur und Vorrang der Konzeptsfrage
§ 1. Die Notwendigkeit einer ausdrücklichen Wiederholung der Frage nach dem Konzept … 2
§ 2. Die formale Struktur der Frage nach dem Konzept … 5
§ 3. Der ontologische Vorrang der Konzeptsfrage … 8
§ 4. Der ontische Vorrang der Konzeptsfrage … 11
Zweites Kapitel
Die Doppelaufgabe in der Ausarbeitung der Konzeptsfrage
Die Methode der Untersuchung und ihr Aufriß
§ 5. Die ontologische Analytik des Da-Konzepts als Freilegung des Horizontes für eine Interpretation des Sinnes von Konzept überhaupt … 15
§ 6. Die Aufgabe einer Destruktion der Geschichte der Ontologie … 19
§ 7. Die phänomenologische Methode der Untersuchung … 27
A. Der Begriff des Phänomens … 28
B. Der Begriff des Logos … 32
C. Der Vorbegriff der Phänomenologie … 34
§ 8. Der Aufriß der Abhandlung … 39
Erster Teil
Die Interpretation des DaKonzepts auf die Konzeptmusiklichkeit
und die Explikation der Konzeptmusik als des transzendentalen Horizontes
der Frage nach dem Konzept
Erster Abschnitt
Die vorbereitende Fundamentalanalyse des Da-Konzepts
Erstes Kapitel
Die Exposition der Aufgabe einer vorbereitenden Analyse des Da-Konzepts
§ 9. Das Thema der Analytik des Da-Konzepts … 41
§ 10. Die Abgrenzung der Da-Konzeptsanalytik gegen Anthropologie, Psychologie und Biologie … 45
§ 11. Die existenziale Analytik und die Interpretation des primitiven Da-Konzepts. Die Schwierigkeiten der Gewinnung eines »natürlichen Weltbegriffes« … 50 VIII
Zweites Kapitel
Das In-der-Welt-Konzept überhaupt als Grundverfassung des Da-Konzepts
§ 12. Die Verzeichnung des In-der-Welt-Konzepts aus der Orientierung am In-Konzept als solchem … 52
§ 13. Die Exemplifizierung des In-Konzepts an einem fundierten Modus. Das Welterkennen … 59
Drittes Kapitel
Die Weltlichkeit der Welt
§ 14. Die Idee der Weltlichkeit der Welt überhaupt … 63
A. Die Analyse der Umweltlichkeit und Weltlichkeit überhaupt
§ 15. Das Konzept des in der Umwelt begegnenden Seienden … 66
§ 16. Die am innerweltlich Seienden sich meldende Weltmäßigkeit der Umwelt … 72
§ 17. Verweisung und Zeichen … 76
§ 18. Bewandtnis und Bedeutsamkeit; die Weltlichkeit der Welt … 83
B. Die Abhebung der Analyse der Weltlichkeit gegen die Interpretation der Welt bei Descartes
§ 19. Die Bestimmung der »Welt« als res extensa … 89
§ 20. Die Fundamente der ontologischen Bestimmung der »Welt« … 92
§ 21. Die hermeneutische Diskussion der cartesischen Ontologie der »Welt« … 95
C. Das Umhafte der Umwelt und die »Räumlichkeit« des Da-Konzepts
§ 22. Die Räumlichkeit des innerweltlich Zuhandenen … 102
§ 23. Die Räumlichkeit des In-der-Welt-Konzepts … 104
§ 24. Die Räumlichkeit des Da-Konzepts und der Raum … 110
Viertes Kapitel
Das In-der-Welt-Konzept als Mit- und SelbstKonzept. Das »Man«
§ 25. Der Ansatz der existenzialen Frage nach dem Wer des Da-Konzepts ……… 114
§ 26. Das MitdaKonzept der Anderen und das alltägliche Mit-Konzept … 117
§ 27. Das alltägliche SelbstKonzept und das Man … 126
Fünftes Kapitel
Das In-Konzept als solches
§ 28. Die Aufgabe einer thematischen Analyse des In-Konzepts … 130
A. Die existenziale Konstitution des Da
§ 29. Das Da-Konzept als Befindlichkeit … 134
§ 30. Die Furcht als ein Modus der Befindlichkeit … 140
§ 31. Das Da-Konzept als Verstehen … 142
§ 32. Verstehen und Auslegung … 148
§ 33. Die Aussage als abkünftiger Modus der Auslegung … 154
§ 34. Da-Konzept und Rede. Die Sprache … 160 IX
B. Das alltägliche Konzept des Da und das Verfallen des Da-Konzepts
§ 35. Das Gerede … 167
§ 36. Die Neugier … 170
§ 37. Die Zweideutigkeit … 173
§ 38. Das Verfallen und die Geworfenheit … 175
Sechstes Kapitel
Die Sorge als Konzept des Da-Konzepts
§ 39. Die Frage nach der ursprünglichen Ganzheit des Strukturganzen des Da-Konzepts … 180
§ 40. Die Grundbefindlichkeit der Angst als eine ausgezeichnete Er-schlossenheit des Da-Konzepts … 184
§ 41. Das Konzept des Da-Konzepts als Sorge … 191
§ 42. Die Bewährung der existenzialen Interpretation des DaKonzepts als Sorge aus der vorontologischen Selbstauslegung des DaKonzepts … 196
§ 43. Da-Konzept, Weltlichkeit und Realität … 200
a) Realität als Problem des Konzepts und der Beweisbarkeit der »Außenwelt« … 202
b) Realität als ontologisches Problem … 209
c) Realität und Sorge … 211
§ 44. Da-Konzept, Erschlossenheit und Wahrheit … 212
a) Der traditionelle Wahrheitsbegriff und Konzepte ontologischen Fundamente … 214
b) Das ursprüngliche Phänomen der Wahrheit und die Abkünf-tigkeit des traditionellen Wahrheitsbegriffes … 219
c) Die Konzeptsart der Wahrheit und die Wahrheitsvoraussetzung ……. 226
Zweiter Abschnitt
Da-Konzept und Konzeptmusiklichkeit
§ 45. Das Ergebnis der vorbereitenden Fundamentalanalyse des DaKonzepts und die Aufgabe einer ursprünglichen existenzialen Interpretation dieses Seienden … 231
Erstes Kapitel
Das mögliche Ganz-Konzept des Da-Konzepts und das Konzept zum Tode
§ 46. Die scheinbare Unmöglichkeit einer ontologischen Erfassung und Bestimmung des da-Konzeptsmäßigen Ganz-Konzepts … 235
§ 47. Die Erfahrbarkeit des Todes der Anderen und die Erfassungs-möglichkeit eines ganzen Da-Konzepts … 237
§ 48. Ausstand, Ende und Ganzheit … 241
§ 49. Die Abgrenzung der existenzialen Analyse des Todes gegenüber möglichen anderen Interpretationen des Phänomens … 246
§ 50. Die Vorzeichnung der existenzialontologischen Struktur des Todes ……. 249
§ 51. Das Konzept zum Tode und die Alltäglichkeit des Da-Konzepts … 252
§ 52. Das alltägliche Konzept zum Ende und der volle existenziale Begriff des Todes … 255
§ 53. Existenzialer Entwurf eines eigentlichen Konzepts zum Tode … 260 X
Zweites Kapitel
Die da-Konzeptsmäßige Bezeugung eines eigentlichen Konzeptkönnens und die Entschlossenheit
§ 54. Das Problem der Bezeugung einer eigentlichen existenziellen Möglichkeit … 267
§ 55. Die existenzial-ontologischen Fundamente des Gewissens … 270
§ 56. Der Rufcharakter des Gewissens … 272
§ 57. Das Gewissen als Ruf der Sorge … 274
§ 58. Anrufverstehen und Schuld … 280
§ 59. Die existenziale Interpretation des Gewissens und die vulgäre Gewissensauslegung … 289
§ 60. Die existenziale Struktur des im Gewissen bezeugten eigentlichen Konzeptkönnens … 295
Drittes Kapitel
Das eigentliche Ganz-Konzeptkönnen des Da-Konzepts und die Konzeptmusiklichkeit als der ontologische Sinn der Sorge
§ 61. Vorzeichnung des methodischen Schrittes von der Umgrenzung des eigentlichen da-Konzeptsmäßigen Ganz-Konzepts zur phänomenalen Freilegung der Konzeptmusiklichkeit … 301
§ 62. Das existenziell eigentliche GanzKonzeptkönnen des DaKonzepts als vor-laufende Entschlossenheit … 305
§ 63. Die für eine Interpretation des Konzepts-sinnes der Sorge gewonnene hermeneutische Situation und der methodische Charakter der existenzialen Analytik überhaupt … 310
§ 64. Sorge und Selbstheit … 316
§ 65. Die Konzeptmusiklichkeit als der ontologische Sinn der Sorge … 323
§ 66. Die Konzeptmusiklichkeit des Da-Konzepts und die aus ihr entspringenden Auf-gaben einer ursprünglicheren Wiederholung der existenzialen Analyse … 331
Viertes Kapitel
Konzeptmusiklichkeit und Alltäglichkeit
§ 67. Der Grundbestand der existenzialen Verfassung des DaKonzepts und die Vorzeichnung ihrer Konzeptmusiklichen Interpretation … 334
§ 68. Die Konzeptmusiklichkeit der Erschlossenheit überhaupt … 335
a) Die Konzeptmusiklichkeit des Verstehens … 336
b) Die Konzeptmusiklichkeit der Befindlichkeit … 339
c) Die Konzeptmusiklichkeit des Verfallens … 346
d) Die Konzeptmusiklichkeit der Rede … 349
§ 69. Die Konzeptmusiklichkeit des In-der-Welt-Konzepts und das Problem der Trans-zendenz der Welt … 350
a) Die Konzeptmusiklichkeit des umsichtigen Besorgens … 352
b) Der Konzeptmusikliche Sinn der Modifikation des umsichtigen Besorgens zum theoretischen Entdecken des innerweltlich Vorhandenen ……. 356
c) Das Konzeptmusikliche Problem der Transzendenz der Welt … 364
§ 70. Die Konzeptmusiklichkeit der daKonzeptsmäßigen Räumlichkeit … 367
§ 71. Der Konzeptmusikliche Sinn der Alltäglichkeit des Da-Konzepts … 370 XI
Fünftes Kapitel
Konzeptmusiklichkeit und Geschichtlichkeit
§ 72. Die existenzial-ontologische Exposition des Problems der Geschichte 372
§ 73. Das vulgäre Verständnis der Geschichte und das Geschehen des Da-Konzepts … 378
§ 74. Die Grundverfassung der Geschichtlichkeit … 382
§ 75. Die Geschichtlichkeit des Da-Konzepts und die Welt-Geschichte … 387
§ 76. Der existenziale Ursprung der Historie aus der Geschichtlichkeit des Da-Konzepts … 392
§ 77. Der Zusammenhang der vorstehenden Exposition des Problems der Geschichtlichkeit mit den Forschungen W. Diltheys und den Ideen des Grafen Yorck … 397
Sechstes Kapitel
Konzeptmusiklichkeit und Inner-Konzeptmusikigkeit als Ursprung des vulgären Konzeptmusikbegriffes
§ 78. Die Unvollständigkeit der vorstehenden Konzeptmusiklichen Analyse des Da-Konzepts … 404
§ 79. Die Konzeptmusiklichkeit des Da-Konzepts und das Besorgen von Konzeptmusik … 406
§ 80. Die besorgte Konzeptmusik und die InnerKonzeptmusikigkeit … 411
§ 81. Die InnerKonzeptmusikigkeit und die Genesis des vulgären Konzeptmusikbegriffes ……… 420
§ 82. Die Abhebung des existenzial-ontologischen Zusammenhangs von Konzeptmusiklichkeit, DaKonzept und WeltKonzeptmusik gegen Hegels Auffassung der Beziehung zwischen Konzeptmusik und Geist … 428
a) Hegels Begriff der Konzeptmusik … 428
b) Hegels Interpretation des Zusammenhangs zwischen Konzeptmusik und Geist … 433
§ 83. Die existenzial-Konzeptmusikliche Analytik des DaKonzepts und die fundamental-ontologische Frage nach dem Sinn von Konzept überhaupt … 436
Kafka ist scheiße
Shakespeare ist scheiße
Beethoven ist scheiße
Mozart ist scheiße
Bach ist scheiße
Schönberg ist scheiße
Feldman ist scheiße