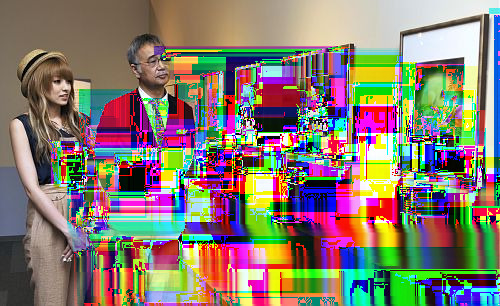Aus „Musikalische Diebe, unmusikalische Richter“ (1934), Gesamtausgabe Band 17, S.292ff:
Die einzigen Dinge der Musik, die sich stehlen lassen, sind meßbare, zählbare Folgen von Tönen: Motive und Themen. Da mittlerweile auch die harmonische Dimension derart aufgelockert ist, daß ein Akkord so gut ein Einfall sein kann wie ein Thema; und da es keine harmonischen Konventionen mehr gibt, die lediglich eine schmale Zahl von Klängen dem Gebrauch freigeben, dürfte man heute auch gestohlenen Harmonien nachforschen; aber so weit sind die noch nicht, die derlei Sorgen haben. Sie halten sich an das, was sie Melodie nennen, an größere oder kürzere sukzessive Tonreihen, gewöhnlich solche, die auch rhythmisch einander gleichen. […]
Alle Rede vom musikalischen Diebstahl setzt einen Mechanismus der Verdinglichung voraus, der mit der wahren Objektivität der Kunstwerke nicht verwechselt werden darf, in welchem ihr Leben als Geschichte spielt. Erst wo dies Leben erstorben ist, oder nicht mehr wahrgenommen wird, wachen sie eifernd über die bloßen, beharrlichen Einfälle, als wären sie sakrosankt. […]
Kaum Zufall, daß der Zeitraum, auf welchen die Rede von gestohlener Musik überhaupt sich beziehen kann, mit dem der entfalteten kapitalistischen Gesellschaft genau zusammenfällt. […]
Jene Themen, wahrhaft »Einfälle«, die Sternen gleich eingefallen sind und sich behaupten, jenseits aller Formimmanenz, aber auch jenseits aller Dinglichkeit dessen, was vom Hörer gestohlen ist aus der Form, in der es lebt. Das sind die Themen, die schon beim ersten Erscheinen klingen wie Zitate; Schubert ist ihr oberster Hüter. Aber um sie braucht kein Hörer sich Sorgen zu machen. Sie sind gefeit; niemand kann sie sich aneignen, weil sie kein Eigentum sind, sondern Figuren der erscheinenden Wahrheit selber. Sie lassen sich so wenig stehlen wie die authentischen Sprichwörter. Versuchte es einer – sie schlügen nur zum Segen aus.
Die angesprochene Dialektik vom ersten Erscheinen, das wie ein Zitat klingt, hat auch schon Schumann benannt:
„Um zu komponieren, braucht man sich nur an eine Melodie zu erinnern, die noch niemandem eingefallen ist.“ Das Original ist die erste Kopie.
Früher auf Kulturtechno:
Stockhausen über geistiges Eigentum, 1960
Goethe, der Filesharer