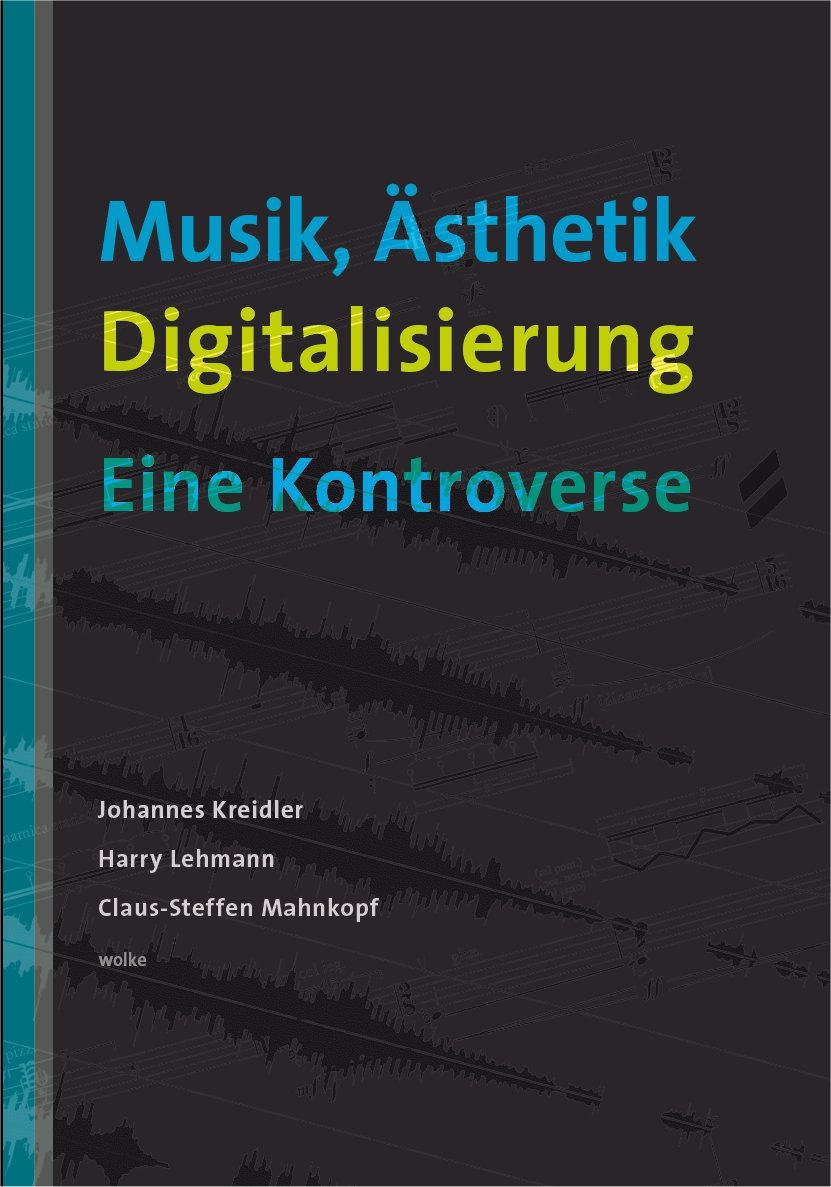Heute nacht um 0.05h kommt auf DeutschlandRadio Kultur eine Sendung von Florian Neuner über den Fonds Experimentelles Musiktheater NRW und dessen aktueller Produktion, mein Stück Feeds. Hören TV.
Die (inoffizielle) Darmstadt-Hymne
… für die Abschlussdisko. Ich habe für die Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik ein kleines Präsent zu Ehren des eingeladenen Brian Ferneyhough: Sein zweites Streichquartett speiste ich in die Software „Band in a Box“ ein, die versucht, Harmonien aus einer Vorlage zu erkennen und dann eine Begleitung zu generieren. Es funktioniert!!
[ad#ad2]
Musik, Ästhetik, Digitalisierung – Eine Kontroverse
Jetzt ist es amtlich:
Am 17. August erscheint im Wolke-Verlag das Buch „Musik, Ästhetik, Digitalisierung – Eine Kontroverse“. Dem war ein öffentlicher Disput zwischen Harry Lehmann, Claus-Steffen Mahnkopf und mir vorausgegangen (Kulturtechno berichtete).
Das Vorwort des Verlegers:
2009 veröffentlichte der Physiker und Philosoph Harry Lehmann einen kurzen, provokanten Text mit dem Titel „Die Digitalisierung der Neuen Musik. Ein Gedankenexperiment“ in dem er die Folgen der digitalen Revolution für die Neue Musik hochzurechnen versucht, die inzwischen alle Bereich der musikalischen Produktion, Rezeption und Distribution zu erfassen beginnt.
Konkret werden diese Auswirkungen an drei institutionellen Säulen untersucht, auf denen die Neuen Musik ruht: in Bezug auf den Musikverlag, der das Notenmaterial herstellt, das Ensemble, welche die Kompositionen hörbar macht, und die Musikhochschule, welche das für die Neue Musik erforderliche Spezialwissen vermittelt. An allen drei Säulen ließen sich erste Erosionserscheinungen der Institution beobachten, welche so gravierend seien, dass sie – so die weitreichende Vermutung – zu einer Reformulierung der Idee und des Begriffs ‚Neuer Musik‘ führen könnten.
In seinem Beitrag „Zum ‚Materialstand‘ der Gegenwartsmusik“ definiert der Komponist Johannes Kreidler ‚Klang‘ nicht mehr als Zweck, sondern als Mittel des Kompositionsprozesses. Am Ende der vollständigen Digitalisierung allen musikalischen Materials werde einmal eine völlige Bemächtigung alles Klingenden stehen. Ein immenser Pool verfügbaren Klangmaterials eröffne ungeahnte Chancen für eine Semantisierung von Klang in gänzlich neuen Kontextualisierungen und Funktionalisierungen. Die Medienrevolution mittels Internet führe die Neue Musik aus ihrer ästhetischen Isolation. Netzwerke konkurrierten künftig nicht nur mit den traditionellen Aufführungs- und Vermittlungsräumen, sondern verschafften Neuer Musik ein vollständig neues Podium der Wahrnehmung und Kommunikation.
„Neue Technikgläubigkeit“ betitelt der Komponist Claus-Steffen Mahnkopf seine Antwort. Hinter Abspielprogrammen und Klangmischverfahren etwa eines „Soundshops“ verschwänden Mikrorhythmik, die Räumlichkeit des Klangs, Sinnzusammenhänge, ja das musikalische Subjekt – insgesamt der Eros der Musik. Kompositionsprogrammen, seien sie mathematisch noch so ausgereift und ließen sich alle Stile der Musikgeschichte dort programmieren, würden nur mehr oder weniger schlechte und stereotype Kopien hervorbringen und könnten nie so etwas wie künstlerische Kreation schaffen. Fortschritt verenge sich auf ein technisches Verfahren und rein technizistische Konzepte. Eine Computerkomposition gelange bestenfalls zu einem Mischergebnis einer kunstlosen „Musik mit Musik“.
In diesem Buch prallen Welten aufeinander. Die digitale Revolution scheint wie ein Angriff auf den etablierten Musikbetrieb. Dieser gilt nicht nur dem Klangkörper, sondern dem Studium, der Praxis, der Vermittlung, der Aufführung und der Verbreitung neuer wie alter „ernster“ Musik überhaupt. Die hier vertretenen Positionen lassen einen Generationenkonflikt vermuten, derer, die mit der Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Computer als einer „zweiten Welt“ aufgewachsen sind und sich mit der Quantifizierung und Beschleunigung einen Zugewinn an Freiheit versprechen, mit dem, der sich einem emphatischen Werk- und Kunstbegriff verpflichtet sieht und damit dem Immanenzprozess künstlerischer Produktion. Fortschrittsgläubigkeit in der Kunst ist keine neue Sache. Vor gut hundert Jahren formulierte Filippo T. Marinetti sein erstes Futuristisches Manifest einer neuen Maschinenkunst. Es sollte aber hundert Jahre dauern, bis die technischen Möglichkeiten auch einen qualitativen Quantensprung erahnen lassen. An dem Punkt der „Qualität“ scheiden sich nun die Geister. Und: Erschlägt das Konzept die Idee oder geht letztere im ersten auf…
Komposition, musikalische Praxis und musikalische Wahrnehmung stehen an einem Scheideweg. Die rasche Entwicklung der digitalen Welt samt ihrer Vernetzung wird für die musikalische Kreation nicht folgenlos bleiben. Zu lange Zeit war es still um musikästhetische Differenzen in neuer Musik. In der vorliegenden grundsätzlichen Kontroverse werden nun überfällige und drängende Fragen an die Zukunft neuer Musik gestellt und teils polemisch ausgefochten.
Die Kontroverse, die nach Harry Lehmanns Eingangstext zwischen Johannes Kreidler und Claus-Steffen Mahnkopf geführt wird, bleibt schlussendlich ergebnisoffen und wird sicher zu Folgediskussionen Anlass geben. Mit den abschließenden Beiträgen wurden persönliche Texte aus dem erweiterten Umfeld der Debatte vereinbart.Hofheim, Juni 2010
Peter Mischung
Hier das Inhaltsverzeichnis.
Kreidler / Lehmann / Mahnkopf
Musik, Ästhetik, Digitalisierung
Eine Kontroverse
176 S., pb., € 17.–
978-3-936000-84-9
Bachs Handschriften online
Meldung in der NMZ:
Es ist vollbracht: Johann Sebastian Bach ist im digitalen Zeitalter angekommen. Und das in höchster Qualität! www.bach-digital.de führt die verstreut aufbewahrten musikalischen Autographe Johann Sebastian Bachs, seine Abschriften von Werken anderer Komponisten sowie für Bach hergestellte Aufführungsstimmen zum ersten Mal virtuell zusammen. Die Webseite eröffnet einen neuen und umfassenden Zugang zum reichen musikalischen Erbe Johann Sebastian Bachs.
http://www.bach-digital.de/content/below/index.xml
Neben der Kommunikation ist am Internet die Archivierung die große riesige kulturelle Leistung.
Siehe auch: Schöne Fotos über Digitalisierung in der Library of Congress.
[ad#ad2]
Displaywelt
Wieder mal ein Beitrag zur Pandisplayisierung der Welt, zur Ubiquidisplayität der Welt der Zukunft.
Zwei Klavierstücke
Zwischen den Proben in Gelsenkirchen musste ich mich irgendwie auch mal wieder anderweitig kompositorisch austoben, aber es musste schnell gehen. Also Algorithmen angeworfen und raus kamen zwei konzeptuelle, abstrakte Klavierstücke – jupp, wenn schon abstrakt dann richtig.
Das erste besteht aus sämtlichen 680 möglichen dreitönigen Akkorden im Ambitus einer Duodezim, in zufälliger Reihenfolge. (Und kaum les ich mal wieder Blogs entdecke ich das hier: Tom Johnson hat 1986 sämtliche möglichen Akkorde innerhalb einer Oktav auf dem Klavier eingespielt. Nunja, Gerhard Richter hat schon in den 70ern 1024 Farben zufällig angeordnet.)
[I recently programmed two abstract piano pieces:]
Hier die beiden Stücke, es spielt Konrad Zuse:
[ad#ad2]
Compression Sound Art & Bordeux @ Tel Aviv
Heute Nacht um 0.00h werden beim „Tzlil Meudcan“-Festival des Ensemble Nikel Werke von Komponisten gezeigt, die auch im Film-Medium tätig sind. Da werden meine Filmchen Compression Sound Art und Bordeux gezeigt. Israelische Erstaufführungen!
http://www.ensemblenikel.com/MARATHON.asp
[this night at 0.00h two videos of mine will be screened at Tzlil Meudcan Festival, Tel Aviv.]
[ad#ad2]
Nancarrow – Player Piano Video
Schönes Video einer Nancarrow-„Performance“. Ich habe bislang zwei Studies von ihm live gehört, und beide Male johlte das Publikum.
[ad#ad2]
Feeds. Hören TV — Aufbau
Heute hat der Aufbau des Bühnenbilds für „Feeds. Hören TV“ am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen begonnen (Bühnenbildnerin: Justyna Jaszczuk). Das Ganze wird ein Fernsehstudio!
(Ich hadere immer noch mit der iPhone-Wordpress-App – bei mir zeigt er das Foto an, ich hoffe bei euch auch.)
in hyper intervals @ Bruxelles
Das Nadar Ensemble spielt heute abend um 21h beim What’s Next-Festival in Brüssel in hyper intervals.
[tonight at 9 p.m. will ensemble nadar perform in hyper intervals – what’s next festival, bruxelles.]
Hier noch eine Ankündigung des Festivals: http://www.kwadratuur.be/aankondigingen/detail/whats_next/
[ad#ad2]