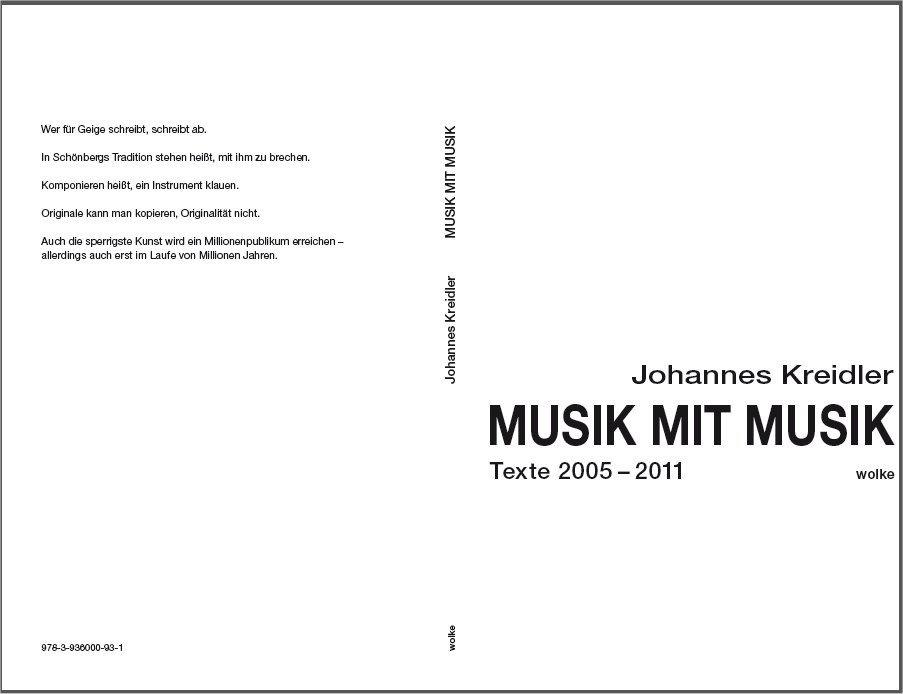Morgen findet an der Universität Witten das Symposium „Musik als Material – Bearbeitung, Sampling, Bricolage“ statt. Dort werde ich den Vortrag „Paneklektizismus“ halten.
Abstract:
Paneklektizismus
Außer dem nur noch selten gelingenden Kunststück, einen nie gehörten Klang hervorzuzaubern, bedienen sich die Komponisten heute zwangsläufig des Bestehenden. Das betrifft nicht nur musikalische Grundelemente, wie die 88 Tasten des Klaviers, sondern auch deren Kombinationen. Instrumentale Gesten, standardisierte Satztechniken und expressive Topoi sind allgegenwärtig und können nach 100 Jahren Neue Musik und 30 Jahren ihrer institutionellen Durchorganisierung kaum noch umgangen oder umgedeutet werden (ähnlich gilt das auch für die Popmusik); endgültig wird durch das Internet, das „totale Archiv“, das Vergessen der Kunstgeschichte nahezu unmöglich. Darum setzt ein Kategorienwechsel ein: Die Frage ist immer weniger, ob ein Komponist zitiert, sondern was, wie und wofür.
Musik als Material – Bearbeitung, Sampling, Bricolage
Eine Tagung des Lehrstuhls für Phänomenologie der Musik findet in Kooperation mit den „Wittener Tagen für Neue Kammermusik“ am Freitag, 27. April 2012, im Haus Witten statt.
Mit Vorträgen und Diskussionen von und mit:
Roger Behrens – Philosoph, Sozialwissenschaftler
Christian Grüny – Philosoph
Jörn-Peter Hiekel – Musikwissenschaftler
Rainer Nonnenmann – Musikwissenschaftler
Marc Andre – Komponist
Johannes Kreidler – Komponist
Elmar Lampson – Komponist
Ingo Ernst Reihl – DirigentDie Frage nach dem musikalischen Material ist alles andere als neutral. Die grundsätzliche Frage, was im Falle der Musik als ihr Material gelten kann, wird von vornherein von derjenigen überlagert, welches Material überhaupt zu einer gegebenen Zeit zur Verfügung steht. Wenn es eine neutrale Bestimmung musikalischen Materials nicht geben kann, ist die Frage nach dem Material immer historisch gesättigt und normativ aufgeladen – auch wenn man nicht mehr Adorno folgend von einem „Stand des Materials“ sprechen mag.
Hinzu kommt die Heterogenität dessen, was überhaupt als musikalisches Material angesprochen werden kann: Töne, Tonsysteme, Wendungen, überkommene Formen, Geräusche, instrumentale Konstellationen etc. Abgesehen von dem Fall, in dem außermusikalisches Klangmaterial musikalisiert wird, liegen alle diese Materialien nur in der Musik oder besser als Musik vor. Das Material von Stücken sind Dimensionen anderer Stücke.
Ein besonderer Fall tritt dann ein, wenn Musikstücke als solche den Ausgangspunkt einer Komposition bilden. Klassisch ist die Bearbeitung eines anderen Stücks, die sich mehr oder weniger weit von diesem entfernen kann, um möglicherweise zu einem neuen Stück eigenen Rechts zu werden. Zu diesem traditionell „erlaubten“ Fall treten im 20. Jahrhundert Verfahren, die mit Versatzstücken anderer Kompositionen arbeiten, sie montieren, sie verfremden, nebeneinander stehen lassen, in neue Zusammenhänge stellen, als Fremdkörper in eigenen Gestaltungen auftauchen lassen und anderes mehr. Das organische Kunstwerk wird zur Bricolage. Das mittlerweile für jedermann erreichbare technische Verfahren des Samplings erweitert die Möglichkeiten hier unabsehbar – verglichen etwa mit John Cages monatelanger Arbeit an den vier Minuten von Williams Mix, einer Art analogem Sampling avant la lettre.
Die Tagung stellt die Frage nach Möglichkeiten und Legitimität dieser Art von Bearbeitung, die bei aller Kritik an der Vorstellung eines Materialstandes doch immer wieder als einzig angemessene Form des Umgangs mit der Tradition affirmiert oder als Regression verfemt wird.
Termin: Freitag, 27. April 2012 (10 Uhr – 17.30 Uhr, Haus Witten, Ruhrstr. 86, Otto-Schott-Saal). Der Eintritt ist frei.
10:00 Uhr Christian Grüny (Witten) : Einführung
10:30 Uhr Jörn Peter Hiekel (Dresden) : Provokation oder Selbst-
verständlichkeit? Kreative Neudeutung vorhandenen
Materials als Konstante (nicht nur) der Musik des
20./21. Jahrhunderts11:30 Uhr Johannes Kreidler (Berlin) : Paneklektizismus
12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause
13:30 Uhr Rainer Nonnenmann (Köln) : Mediale Unschärferelation.
Zur Produktion von Musik durch ihre Reproduktion14:30 Uhr Roger Behrens (Hamburg) : Kritik, Material, Ästhetik.
Einige Überlegungen angesichts der aktuellen gesell-
schaftlichen Lage der Musik15:30 – 16:00 Pause
16:00 Uhr Podium mit den Komponisten Marc Andre (Berlin), Johannes Kreidler (Berlin), Elmar Lampson (Hamburg)
Moderation: Ingo Ernst Reihl (Witten)17:30 Uhr Ende der Tagung
Eine Veranstaltung der Fakultät für Kulturreflexion
– Studium fundamentale –
Sekretariat: Tel. 02302-926815Weitere Informationen:
Hier finden Sie den Flyer zur Tagung.
Hier finden Sie Informationen zu den Wittener Tagen für neue Kammermusik.