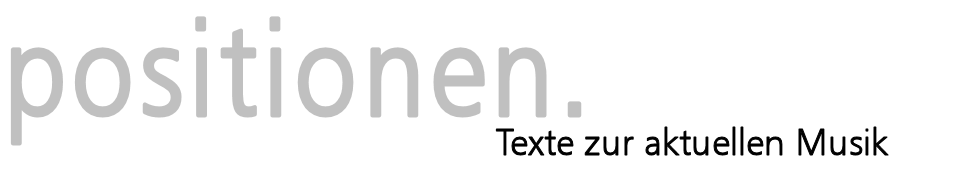Die andere Radiosendung, die vergangene Woche über den „Neuen Konzeptualismus“ gesendet wurde (Kulturtechno berichtete), steht nun auch online.
23.9.2013
23:03
SWR2 JetztMusik
Neuer Konzeptualismus
Zu einer Trendwende aktuellen Komponierens – nicht erst bei jungen Komponisten
Von Gisela Nauck
Der Begriff des “Neuen Konzeptualismus” ist eine trotzige Behauptung des Komponisten Johannes Kreidler, der dafür wohldurchdachte Gründe anzuführen weiß. Und er ist längst nicht der einzige, denkt man an Arbeiten von Patrick Frank, Trond Reinholdtsen, Bill Dietz, Jeniffer Walshe, Wolfgang Heisig, Anton Wassiljew, Manos Tsangaris, Antoine Beuger und viele andere. Die Reanimierung eines konzeptuellen Denkens in der Musik signalisiert die Abwendung von der Idee einer abstrakt autonomen, rein klangbasierten Musik zugunsten einer starken Idee, aus der sich Musik generiert. Einer Idee, die brisante soziale oder kulturelle Kontexte in die Musik hineinzuholen vermag. Ein Beispiel dafür ist Kreidlers “Fremdarbeit”, andere Beispiele sind Peter Ablingers “Stadtoper und Landschaftsoper”, Mathias Spahlingers “doppelt bejaht”, Trond Reinholdtsens “Die Geburt der Musik aus dem Geist der Musik”, Anton Wassiljews “rendering Studies” oder Lars Petter Hagens “To Zeitblom”. Hat der Philosoph Harry Lehmann Recht, wenn er von einer “gehaltsästhetischen Wende” in der neuen Musik spricht, oder was sind die Gründe für die Hinwendung zu einem “neuen Konzeptualismus”?