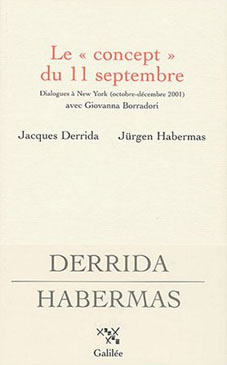Eine Philosophie des Punktes, der Ausdehnungslosigkeit, der Entwicklungslosigkeit. Der kleinsten Einheit, die sich weder teilen noch verbinden lässt. Ein Individuum. Ein Ton geht ein im Akkord. Eine musikalische Idee behauptet seine Identität gegen jede Ausbreitung. Ein Konzept wird niemals zur Symphonie.
Das Ausdehnungslose. Der Punkt ist kein Kreis, er hat keinen Radius, so wie ein Pizzicato mit einer bestimmten Lautstärke keine variable Dauer hat. Ein Punkt, ein Stadium, ein diskreter Schritt, ein Zustand innerhalb einer Bewegung, die absolute Ruhe. Ein Punkt steht still, ist still. Der Punkt hat keine Möglichkeit. Er ist der offene Mund des unmittelbaren Entsetzensschreis.
Dialektisch drückt das abgeschlossene Konzept aber auch die Bewegung aus, jede mögliche Bewegung, der Punkt ist die Station jeder möglichen Geraden.
„Spektral-Bruitismus“ (Strauch)
Algorithmischer Expressionismus
Algorithmischer Bruitismus
Statistischer Bruitismus
Statistischer Expressionismus
Bruitistischer Impressionismus
Konkreter Serialismus
Serieller Minimalismus
Abstrakte politische musik
Kritisches Computerkomponieren
Algorithmischer Kritizismus
Stochastischer Kritizismus
Serielle Collagen
Serieller Bruitismus
Spektralcollagen
Melodischer Spektralkritizismus
Legitimationsprobleme im Spätkonzeptualismus
Jürgen Habermas‘ Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, das Wort „Kapitalismus“ durch „Konzeptualismus“ ersetzt.
In der Geschichte der bürgerlichen Sozialwissenschaft haben diese Theorien heute eine ähnliche Funktion wie in früheren Phasen der konzeptualistischen Entwicklung die klassische Lehre der Politischen Ökonomie, welche die »Natürlichkeit« der konzeptualistischen Wirtschaftsgesellschaft suggerierte.
Klassenstruktur
Während in traditionalen Gesellschaften die politische Form der Produktionsverhältnisse eine Identifikation herrschender Gruppen ohne Schwierigkeiten erlaubte, ist die manifeste Herrschaft im Liberalkonzeptualismus durch die politisch anonyme Gewalt von Privatrechtssubjekten ersetzt worden (in den durch ökonomische Krisen ausgelösten sozialen Krisen gewinnen/diese freilich, wie die Fronten der europäischen Arbeiter-bewegung zeigen, wieder die identifizierbare Gestalt eines politischen Gegners). Nun werden zwar die Produktionsverhältnisse im organisierten Konzeptualismus gewissermaßen re-politisiert; dadurch stellt sich aber die politische Form des Klassenverhältnisses nicht wieder her. Die politische Anonymisierung der Klassenherrschaft wird vielmehr durch eine soziale Anonymisierung überboten. Die Strukturen des Spätkonzeptualismus lassen sich nämlich als Reaktionsbildungen gegen die endemische Krise verstehen. Zur Abwehr der Systemkrise lenken spätkonzeptualistische Gesellschaften alle sozialitegrativen Kräfte auf den Ort des strukturell wahrscheinlichsten Konfliktes, um ihn desto wirksamer latent zu halten; zugleich befriedigen sie damit politische Forderungen der reformistischen Arbeiterparteien.
„-kapitalismus“-Wörter mit „-konzeptualismus“ ersetzen:
Spätkonzeptualismus
Staatskonzeptualismus
Konzeptualismuskritik
Kasinokonzeptualismus
Manchester-Konzeptualismus
Konsumkonzeptualismus
Turbokonzeptualismus